Der BGH hat aktuell entschieden, dass Banken und Sparkassen keine Negativzinsen auf Spar- und Tagesgeldkonten erheben dürfen. Bei Girokonten sind sog. Verwahrentgelte zwar grundsätzlich zulässig. Allerdings müssen die entsprechenden Vertragsklauseln transparent gestaltet sein, damit Kunden nachvollziehen könnten, wie die Entgelte berechnet werden, fehlt diese Transparenz, sind auch hier Negativzinsen unzulässig.
Hintergrund
Während der Niedrigzinsphase, die im Mai 2022 ihren Höhepunkt erreichte, verlangten mindestens 455 Banken und Sparkassen in Deutschland von ihren Kunden Negativzinsen.
Die meisten Institute orientierten sich dabei am negativen Einlagezins der Europäischen Zentralbank (EZB) und berechneten einen Strafzins von 0,5 Prozent auf Guthaben, die einen bestimmten Freibetrag überschritten. Einige Banken setzten diesen Freibetrag bereits bei 5.000 oder 10.000 Euro an, womit auch Klein- und Durchschnittssparer betroffen waren.
Die Vereinbarungen die „Negativzinsen“ hatte aus Bankensicht den Zweck, in einem wirtschaftlichen Umfeld, in dem die Banken selbst mündelsichere Erträge nicht erzielen konnten, wenigstens die laufenden Kosten zu decken. Den aktuellen BGH-Entscheidungen liegen Klagen von Verbraucherzentralen gegen mehrere Banken zugrunde, darunter die Sparda-Bank, die Commerzbank, eine Sparkasse und eine Volksbank.
BGH verwirft klauselartig vereinbarte Verwahrentgelte („Negativzinsen“)
Nach den aktuellen BGH-Urteilen muss bei der durch Bankenklauseln vereinbarten Erhebung von Verwahrentgelten („Negativzinsen“) differenziert werden:
- Die Erhebung von Verwahrentgelten auf Spar- und Tagesgeldkonten würde nach Ansicht des BGH den Charakter dieser Einlagen verändern, da sie neben der Verwahrung auch der Geldanlage und dem Sparen dienen. Verbraucher würden dadurch unangemessen benachteiligt, so der BGH. Klauseln über Verwahrentgelte für Einlagen auf Tagesgeldkonten (XI ZR 161/23) und für Spareinlagen (XI ZR 183/23) unterliegen einer AGB-rechtlichen Inhaltskontrolle, weil sie die von der Bank geschuldete Hauptleistung abweichend von der nach Treu und Glauben geschuldeten Leistung verändern. Sie halten der Inhaltskontrolle nicht stand, weil sie von wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung abweichen und die Verbraucher entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen (§ 307 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB). Einlagen auf Tagesgeldkonten und Sparkonten dienen nicht nur der sicheren Verwahrung von Geldern, sondern darüber hinaus auch Anlage- und Sparzwecken.
- Anders verhält es sich jedoch bei Girokonten (BGH XI ZR 61/23, XI ZR 65/23 und XI ZR 161/23): Hier stelle die Verwahrung des Geldes eine Hauptleistung der Bank dar, weshalb Verwahrentgelte grundsätzlich zulässig seien, meint der BGH. Allerdings müssten die entsprechenden Vertragsklauseln transparent gestaltet sein (§ 307 Abs. 1 S.1 BGB), damit Kunden nachvollziehen könnten, wie die Entgelte berechnet werden. Fehle es an dieser Transparenz, seien auch hier Negativzinsen unzulässig: Die Klauseln informieren in den Streitfällen nicht hinreichend genau darüber, auf welches Guthaben sich das Verwahrentgeltbezieht; die auf Girokonten bestehenden Guthaben können sich infolge der Verbuchung von Gutschriften und Belastungen innerhalb eines Tages mehrfach ändern.
Kosten für Ersatz-BankCard und Ersatz-PIN
Im Verfahren XI ZR 161/23 hat der BGH schließlich auch entschieden, dass Bankklauseln zu einem Entgelt für die Ausstellung einer Ersatz-BankCard bzw. einer Ersatz-PIN unwirksam sind, da sie gegen das Transparenzgebot nach § 307 Abs. 1 S. 2 BGB verstoßen. Der Verbraucher kann nicht hinreichend erkennen, in welchen Fällen die Bank zur Ausstellung einer Ersatzkarte bzw. einer Ersatz-PIN verpflichtet ist, und damit nicht, ob er das dafür gezahlte Entgelt tatsächlich zahlen muss. Der durchschnittliche, rechtlich nicht gebildete, verständige Verbraucher erkenne zwar, dass er nach den Klauseln nur dann zur Zahlung verpflichtet sein soll, wenn weder eine gesetzliche noch eine vertragliche Verpflichtung der Bank zur Ausstellung einer Ersatzkarte bzw. einer Ersatz-PIN besteht. In den Klauseln fehle aber jegliche Konkretisierung, wann eine solche Verpflichtung der Bank bestehe. Ausführungen über die typischen Fälle, in denen der Verbraucher eine Ersatzkarte bzw. eine Ersatz-PIN benötigt (Verlust, Diebstahl und Missbrauch), enthalten die Klauseln nicht. Die Entgeltklauseln versetzen den Verbraucher damit nicht in die Lage, die Reichweite der beabsichtigten Entgeltpflicht in seinem praktischen Geltungsbereich zu bestimmen.
Praktische Folgen der Entscheidungen
Wichtig ist, dass die BGH-Urteile nicht zu einer automatischen Rückzahlung zu Unrecht gezahlter Negativzinsen führen, insoweit fehlte es in den Musterverfahren an der Aktivlegitimation der Verbraucherverbände. Betroffene Kunden sollten nun aktiv werden, Auskunft ihrer Bank zur Frage der einschlägigen Betroffenheit einholen und ggf. bereits gezahlte Negativzinsen zurückfordern. Das bedeutet: Wer in der Vergangenheit Negativzinsen gezahlt hat, der sollte sich schnellstmöglich rechtliche Beratung suchen und bei seiner Bank die Beträge zurückfordern“ Beratung gibt es bei auf Kapitalanlage und Bankrecht spezialisierten Rechtsanwälten oder Verbraucherschutzverbänden. Vergleichbare Maßstäbe gelten bei der ausnahmslosen und nicht erklärten Anforderung von Entgelten für Ersatzkarten oder eine Ersatz-PIN.
Für die Zukunft hat der BGH der Vereinbarung von Verwahrentgelten (Negativzinsen) zwar nicht per se einen Riegel vorgeschoben. Im aktuellen Zinsumfeld haben die BGH- Entscheidungen derzeit keine praktische Relevanz.Dennoch muss bei künftiger Wiederholung einer länger anhaltenden Niedrigzinsphase bei einem Comeback von Negativzinsen der vom BGH rechtlich noch zugelassenen Rahmen eingehalten wird. Dies wird jedenfalls beanstandungsfrei dann möglich sein, wenn Banken solche Vereinbarungen auf Basis einer individuellen Beratung und Vertragsreglung im Einzelfall treffen, bei der die erforderliche Transparenz für den Geschäfts- oder Privatkunden hergestellt wird.
Weitere Informationen
BGH Pressemitteilung Nr. 26/2025 v. 4.2.2025
Ein Beitrag von:
-
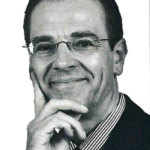
- Studium der Rechtswissenschaften in Würzburg
- Hauptgeschäftsführer der IHK Würzburg-Schweinfurt
- Honorarprofessor an der Universität Würzburg
Warum blogge ich hier?
Mein erster Blog bietet die Möglichkeit, das Thema der Pflicht der „Pflichtmitgliedschaft in Kammern“ „anzustoßen“ und in die Diskussion zu bringen. Bei genauem Hinsehen sichert der „Kammerzwang“ nämlich Freiheitsrechte durch die Möglichkeit zur eigenverantwortlichen Partizipation.